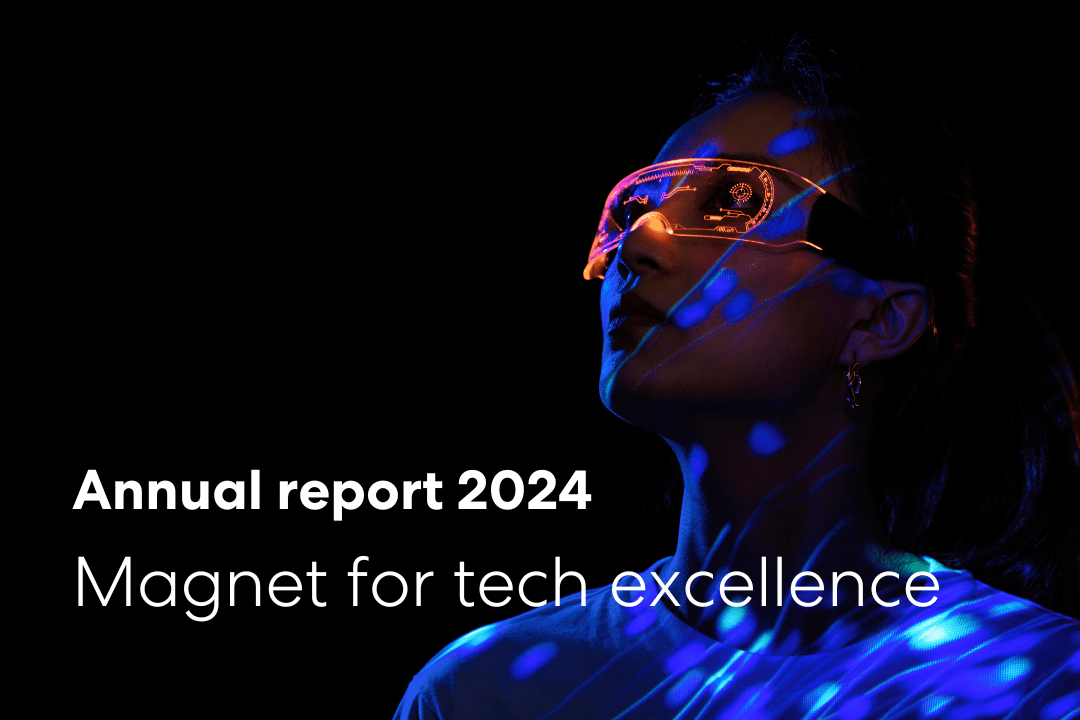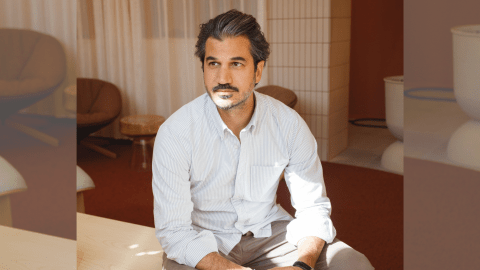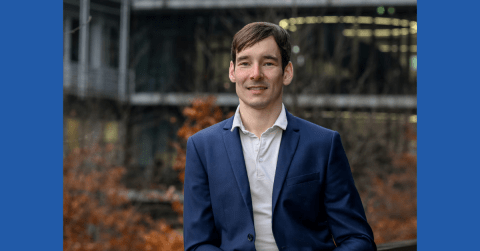Während Supermächte Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, verfolgt die Schweiz ihren eigenen Weg - dezentral, innovativ und erfolgreich. Von Crypto Valley bis zur ETH Zürich zeigt das Land, wie clevere Strategien und Kooperationen auf Augenhöhe zum globalen Vorteil werden. Ein Blick hinter die Kulissen einer unterschätzten Tech-Nation.
Zum Autor: Alexander Brunner ist Gründer von Brunner Digital, einem Beratungsunternehmen für Tech-Ökosysteme mit Kunden in den USA, Europa und Asien. Er ist Präsident von Home of Blockchain.swiss

Das grosse Schweizer KI-Geheimnis
Die Einführung von ChatGPT 3.5 im November 2022 löste weltweit ein Wettrennen um künstliche Intelligenz (KI) aus. Die USA führten dieses Rennen an und stellten Hunderte von Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur bereit. KI wird heute als nächste grundlegende Technologie betrachtet – vergleichbar mit Elektrizität oder dem Internet. Viele Länder, darunter die USA, Grossbritannien und Singapur, haben deshalb umfassende KI-Investitionsstrategien lanciert. Dieses globale Wettrennen stellt kleinere Länder vor die Frage, wie sie in diesem gewaltigen Infrastrukturwettlauf mithalten können. Die Schweiz, ein Land mit nur rund neun Millionen Einwohnern, könnte eine interessante Antwort darauf bieten.
Auf der Viva Technology 2024 in Paris nannte Yann LeCun, Metas KI-Chef, die Schweiz überraschend als einen zentralen Forschungsstandort für KI. Trotz ihrer geringen Grösse beherbergt die Schweiz Spitzenuniversitäten wie die ETH Zürich und die EPFL Lausanne sowie Forschungslabore von Google, Disney, Apple und Amazon. Wie kam es dazu? In meinem Buch „The Big Swiss AI Secret“, basierend auf über 70 Interviews mit führenden Schweizer KI-Expert:innen, habe ich eine überraschende Antwort gefunden.
Der Erfolg von Crypto Valley und die Kraft der Dezentralisierung
Seit die ersten Krypto-Unternehmen in die Schweiz kamen, hat sich das Land zu einem führenden Zentrum für Blockchain-Technologie entwickelt. Innerhalb eines Jahrzehnts ist aus einem lokalen Projekt in Zug ein nationales Ökosystem entstanden. Das renommierte Krypto-Magazin Coindesk setzte das Schweizer Crypto Valley auf Platz 1 – noch vor den USA, Grossbritannien und der EU. Dieser Erfolg wurde ohne nationale Krypto-Strategie oder staatliche Investitionen erzielt – im Gegenteil. Das politische System der Schweiz ist stark dezentralisiert: 26 Kantone verfügen über grosse Eigenständigkeit und fördern eine kooperative Kultur. Das Crypto Valley entstand aus einer Graswurzelbewegung, angetrieben von internationalen Unternehmer:innen, die sich über Bitcoin austauschten. Die ersten Unternehmen wurden 2013 gegründet, und Zug wurde schnell zu einem globalen Blockchain-Hub. Andere Kantone zogen nach: Zürich punktete mit seinem Bankensektor, die Romandie mit ihrer lebendigen Startup-Kultur. Erst später führte die Bundesregierung ein DLT-Regelwerk ein, das von Kantonen und der Finanzaufsicht FINMA unterstützt wurde.
Dieser dezentrale Ansatz spiegelt das Prinzip der Blockchain selbst wider – ein verteiltes Netzwerk, das durch Konsens eine „einzige Wahrheit“ aufrechterhält. Es verhindert Betrug und Doppel-Ausgaben digitaler Werte. Ethereum, eine der wegweisenden Open-Source-Blockchains, wurde 2014 in Zug gegründet. Mitgründer Vitalik Buterin wollte sich nicht in den USA niederlassen – zu gross war das regulatorische Risiko. Die Schweiz bot durch ihre Datenschutzgesetze und dezentrale Struktur den idealen Standort. Der Schweizer Anwalt Luka Müller half bei der Gründung der Ethereum-Stiftung – heute sind über 150 weitere Blockchain-Stiftungen wie Solana oder Cardano in der Schweiz registriert. Das Gleichgewicht von Freiheit und Regulierung macht das Land attraktiv für Tech-Unternehmer:innen. Diese Offenheit und Dezentralität stärken auch das KI-Ökosystem der Schweiz und schaffen Vertrauen.

Die Schweizer Freiheit zur Innovation
Die Schweiz belegt 2024 erneut Platz 1 im Global Innovation Index, ein Beweis für ihre Innovationskultur. Der Erfolg basiert auf einer dezentralen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften. Universitäten wie ETH Zürich und EPFL betreiben nicht nur Spitzenforschung, sondern arbeiten eng mit der Industrie zusammen, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Das Schweizer Modell fördert Innovation durch flexible, lokale Kooperationen – im Gegensatz zu den zentralistisch organisierten Grossprojekten vieler grösserer Länder.
In der Schweiz werden Ideen schnell getestet und an lokale Bedürfnisse angepasst. Während die Regierung in anderen Ländern stark in Technologieprojekte eingreift, lässt die Schweiz private Akteure vorangehen. Der Staat schafft günstige Rahmenbedingungen, aber mischt sich wenig ein – basierend auf zwei Grundsätzen: minimale staatliche Einmischung und innovationsfördernde Marktkräfte. Programme wie Innosuisse bieten Unterstützung in der Frühphase, später übernehmen private Investoren. Diese Freiheit zur Innovation ist ein zentraler Erfolgsfaktor in den Bereichen KI und Blockchain.
Unternehmer:innen lieben die Schweiz
Die Schweiz ist Heimat erfolgreicher KI-Startups – viele stammen als Spin-offs von der ETH Zürich, die in den letzten 50 Jahren 583 Ausgründungen hervorgebracht hat. Zwar ist die Schweiz führend in der Technologieentwicklung, jedoch fällt es Startups manchmal schwer, Venture Capital zu sichern. Ein US-Investor erklärte kürzlich, dass Schweizer Startups technologisch stark sind, aber im Storytelling – also der überzeugenden Darstellung gegenüber Investoren – weniger geübt als ihre US-Pendants. Das kann zu niedrigeren Bewertungen führen.
Dennoch ziehen Schweizer Startups internationale Investoren an: So sammelte Swiss-Mile 22 Mio. USD – mit Beteiligung von Bezos Expeditions. 2022 erhielten Schweizer Startups insgesamt 3,1 Mrd. CHF an Kapital – mit wachsender Tendenz. Unternehmen wie Climeworks oder WeFox konnten grosse Finanzierungsrunden abschliessen, und Firmen wie Scandit erreichten Unicorn-Status. Die Schweiz mag klein sein – aber sie bringt hochinnovative, global relevante Unternehmen hervor.
Schweizer Startups drängen ins Ausland
Die Schweiz ist seit Jahren Innovationsweltmeister – auch 2024 laut WIPO. Doch mit nur 9 Millionen Einwohnern ist der Binnenmarkt begrenzt. Internationale Expansion ist essenziell. Viele Schweizer Startups streben früh in die USA – einen wichtigen Handelspartner: 2022 betrug der bilaterale Handel über 185,9 Mrd. USD.
Im Gegensatz zum stark vertriebsorientierten US-Markt setzt die Schweiz auf Qualität und partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Das dezentrale politische System mit direkter Demokratie begünstigt flache Strukturen und internationale Partnerschaften. Gleichzeitig beherrschen US-Unternehmen das Storytelling meisterhaft. Die Kombination aus kleinem Heimatmarkt und begrenztem Sales-Talent treibt Schweizer KI-Firmen in den US-Markt. Trotz harter Konkurrenz bietet dieser grössere Belohnungen. Schweizer Technologie passt gut zu den Bedürfnissen des US-Markts – und ergänzt die langjährige Handelsbeziehung.

Internationale Investoren reissen sich um Schweizer Startups
Als Steve Jobs am 9. Januar 2007 das iPhone vorstellte, veränderte er die Welt. Über 2,3 Milliarden Geräte wurden seitdem verkauft. Eine Schlüsseltechnologie – Face ID – basiert zum Teil auf Patenten des Zürcher Startups Faceshift (ein EPFL-Spin-off), das 2015 von Apple übernommen wurde. Solche erfolgreichen Exits machen die Schweiz attraktiv.
Anfang 2024 erhielt Swiss-Mile überraschend einen Anruf von Bezos Expeditions – 22 Mio. USD für ihr laufradbetriebenes Robotersystem. Im November 2024 gab Cradle.bio, ein Schweizer KI-Startup für Protein-Engineering, eine grosse Finanzierungsrunde über insgesamt 100 Mio. USD bekannt – angeführt von Index Ventures und Institutional Venture Partners.
Doch nicht alle Exits gehen in die USA: Das ETH-Spin-off Sevensense wurde 2021 zunächst von ABB Ventures unterstützt und im Januar 2024 vollständig von ABB übernommen.
Die Schweiz als KI-Talent-Hub
Neben Technologie und Kapital ist Talent entscheidend – und hier führt die Schweiz weltweit. Laut IMD Talent Ranking und dem Global Talent Competitiveness Index von INSEAD steht die Schweiz seit Jahren auf Platz 1. Hohe Lebensqualität, wirtschaftliche Freiheit und politische Stabilität bilden ein ideales Innovationsumfeld.
So ist die Schweiz auf Platz 4 der weltweit KI-intensivsten Länder (Tortoise Media) – hinter den USA, China und Israel. Zwar fehlt eine grosse Vertriebsplattform wie Microsoft (bei OpenAI), aber mit starken Universitäten und schneller KI-Adaption – etwa in der Finanzbranche – wächst die Bedeutung des Landes. ETH und EPFL sollen Fachkräfte für die Privatwirtschaft ausbilden. In der heutigen KI-Wirtschaft verdienen Top-Talente 1–2 Mio. USD jährlich – die Nachfrage ist riesig. Firmen wie Google, Nvidia und Apple rekrutieren gezielt Schweizer Talente. Gleichzeitig mangelt es an Vertriebs- und Business-Expertise im Inland. Viele Schweizer Startups zieht es deshalb in die USA, um zu wachsen.
Wie kleine Länder mit Innovationskraft mithalten können
Die biblische Geschichte von David gegen Goliath zeigt, dass Intelligenz Grösse schlagen kann. Gilt das auch für KI? Auf der VivaTech 2024 betonte Yann LeCun erneut die zentrale Rolle der Schweiz. Anders als rein digitale KI-Systeme müssen Roboter mit der realen Welt interagieren – was deutlich komplexer ist.
Das US-Unternehmen Boston Dynamics dominiert diesen Bereich seit Jahrzehnten – wird aber nun durch Anybotics aus Zürich herausgefordert. Weniger Ressourcen bedeuten oft mehr Kreativität: So wie die UdSSR mit Einfallsreichtum statt Kapital gegen die NASA antrat, setzen Schweizer Unternehmen auf clevere Ingenieurskunst statt Rechenpower.
Zürichs KI-Cluster, rund um die ETH, zeigt, wie man trotz kleiner Größe weltweit mitspielen kann. Schweizer KI-Expert:innen glauben nicht an eine rein „brute-force“-basierte Zukunft. Sie betonen, dass wahre Intelligenz mehrdimensional ist – und kollektive Problemlösung, Interdisziplinarität und Experimentierfreude entscheidend sind.
Yann LeCun brachte es auf den Punkt: „KI ist nicht einmal so klug wie eine Ratte.“ Mehr Rechenleistung allein wird keinen Supermenschen erzeugen. Grösse ist nicht alles – David hat gewonnen, weil er klüger war. Und genau das ist die Schweizer KI-Strategie.
GZA Jahresbericht 2024
GZA Jahresbericht 2024
2024 entschieden sich 91 internationale Unternehmen für die Greater Zurich Area als Sprungbrett für ihren globalen Erfolg. Unternehmensansiedlungen aus Biotech, Blockchain, Cleantech und einem AI-Boom bestätigen die Region ihre Rolle als führender Innovationshub.
Was steckt hinter den Zahlen?
Kontaktieren Sie uns
Unsere Services sind kostenlos und beinhalten:
- Vermittlung von Schlüsselkontakten in Industrie, Wissenschaft und Verwaltung
- Beratung zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Steuern, Arbeit, Markt und Unternehmensgründung
- Massgeschneiderte Besichtigungen, einschließlich Büro- und Co-Working-Space